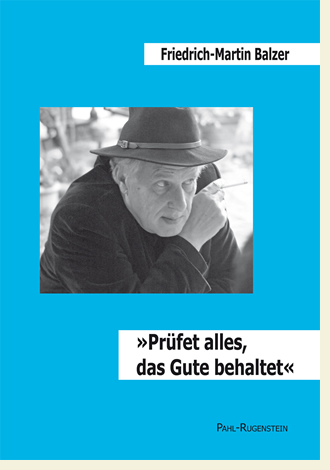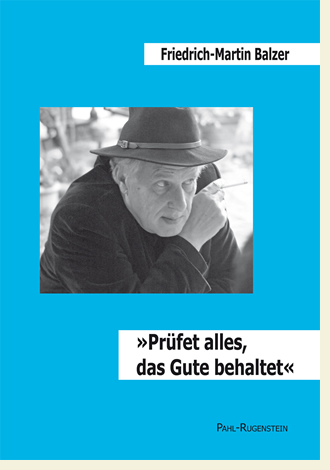
Der Publizist Friedrich-Martin Balzer legt mit diesem Sammelband ausgewählte Schriften seit 1998 vor. Der Titel (1 Thess 5,19-21) geht zurück auf den Trauspruch, den sein Vater ihm 1968 mit auf den Weg gab.
In der vorliegenden Sammelschrift geht Balzer auf Spurensuche nach zukunftsweisenden Gestalten der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Im Mittelpunkt steht der badische Pfarrer und revolutionäre Sozialist Erwin Eckert (1893-1972). Darüber hinaus widmet sich der Autor dem Wirken von Wolfgang Abendroth, Emil Fuchs, Kurt Julius Goldstein, Hans Heinz Holz, Eric Hobsbawm, Robert Neumann, Helmut Ridder und Wolfgang Ruge.
Die persönlichen Erinnerungen Balzers an die 50er Jahre fanden die Bewunderung Eric Hobsbawms, der Umfang und Genauigkeit seines Erinnerungsvermögens an jene „kalten Zeiten“ rühmt, in denen Balzer als Jazz-, Film-, Literatur- und Theaterliebhaber den postfaschistischen Nachkriegsjahren ein erstaunlich umtriebiges, eigenständiges und widerborstiges Leben abgewinnt.
Die hier erstmalig veröffentlichte Streitschrift über „Die Mitverantwortung des deutschen Protestantismus für Faschismus und Holocaust“ verdeutlicht die Generalintention der Arbeiten Balzers in den letzten vier Jahrzehnten. „What you have written is very important and should be widely distributed. Please keep your voice loud and clear – there are so many people who need to hear you”, so Susannah Heschel, Verfasserin des grundlegenden Werkes „The Aryan Jesus: Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany“, in einem Brief an den Autor.
Hans Heinz Holz schreibt in seiner „Kleinen Eloge auf einen Freund“: „Der Historiker Balzer verstand von Anbeginn seines Studiums, daß der Faschismus die terroristische Herrschaftsform des Kapitalismus ist. Sein Antifaschismus konnte sich nicht auf die moralische Verurteilung des Unrechts beschränken, sondern mußte in erster Linie den gesellschaftlichen Ursachen gelten. Das heißt: Dem Kapitalismus ein System mit menschlicher Perspektive entgegensetzen. Es war eine Selbstverständlichkeit, daß Martin Sozialist wurde‚ wie jene Theologen, denen sein Arbeitsinteresse sich zuwendete. Selbstverständlich, wenn man Wolfgang Abendroth nicht nur zum akademischen Lehrer hatte, sondern auch als gedanklichen Wegweiser und menschliches Vorbild wählte. Nicht ganz so selbstverständlich ist es, wie sich gezeigt hat, daß man diese Einstellung im Wandel der Zeiten und Opportunitäten auch durchhält. Martin ist immer geblieben, als der er angetreten ist, aus Entscheidungen, die auf Gründen beruhten“.
Der Sammelband schließt mit einem Essay aus bürgerlich-liberaler Sicht von Manfred Gailus: „Iserlohner Pfarrersohn, Marburger Achtundsechziger und protestierender Post-Protestant. Friedrich-Martin Balzer zum Siebzigsten“.
Fenster schliessen Seitenanfang
Inhalt
Hans Heinz Holz: Kleine Eloge auf einen Freund............................................................................................ |
|
Erwin Eckert – Badischer Pfarrer und
revolutionärer Sozialist (1893-1972).................................................... |
|
Meine unterwanderten Jahre – Satirische Bemerkungen................................................................................. |
|
Mentalitätsgeschichte akademischer Mittelschichten. ..................................................................................... |
|
Emil Fuchs: Erbe der Französischen Revolution und des Roten Oktober......................................................... |
|
»Auf beiden Augen blind – immer noch!« Zur »Erklärung der Badischen Landeskirche«.................................. |
|
»Es war Liebe auf den ersten Blick«.
Grußwort zum 85. Geburtstag von Kurt Julius Goldstein........................ |
|
Kein Einzelschicksal. Trauerrede auf Wolfgang Eckert................................................................................... |
|
Ein guter Jahrgang.
Wolfgang Ruge schreibt Geschichte – Hobsbawm auch.................................................... |
|
Der Sohn von Pfarrer Samuel. Interview........................................................................................................ |
|
Zwischen Gefängnis und Zuchthaus. Alltag des Erwin Eckert.......................................................................... |
|
Das war das Leben. Trauerrede für Juliane Eckert......................................................................................... |
|
Wolfgang Abendroth als literarischer Ratgeber
der organisierten Studentenbewegung (1961-1967)................. |
|
Persönliches und Politisches:
Erinnerungen an Robert Neumann (1961-1975)................................................. |
|
»Die Heldenrolle liegt mir nun wirklich nicht«.
Wolfgang Abendroth im griechischen Widerstand...................... |
|
Der »revolutionäre Kommunist« Wolfgang Abendroth und
der »kommunistische Christ« Erwin Eckert.
Eine Parallel-Biographie................................................................................................................................ |
|
Wolfgang Abendroth Ein Marxist des 20. Jahrhunderts auch für das 21.......................................................... |
|
Dossier: Ehrendoktorwürde für Helmut Schmidt.
Was würden Wolfgang Abendroth und Helmut Ridder
dazu sagen?.................................................................................................................................................. |
|
Hans Heinz Holz als Publizist. Ein Zwischenbericht......................................................................................... |
|
Wolfgang Ruge – Historiker in extremen Zeiten.............................................................................................. |
|
Ein Leben für Wissenschaft, Recht und Frieden.
Helmut Ridder (1919-2007)................................................. |
|
Christliche Quereinsteiger haben es in der DKP schwer.................................................................................. |
|
Rückblicke und Einblicke in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Ein Fragebogen.................................... |
|
Nach 50 Jahren: Der Düsseldorfer Prozeß.
Die Friedensbewegung auf der Anklagebank des Kalten Krieges......................................................................................................................................................... |
|
Wider die falschen Götter im Himmel und auf Erden.
Erinnerung an den deutschen Befreiungstheologen
Erwin Eckert................................................................................................................................................. |
|
Lehrer und Aufklärer. Helge Speith zum 80. Geburtstag................................................................................. |
|
Eric Hobsbawms frühe publizistische Arbeiten
zur Literatur (1944-1946)....................................................... |
|
Die Mitverantwortung des deutschen Protestantismus
für Faschismus und Holocaust. Eine Streitschrift............ |
|
Manfred Gailus: Iserlohner Pfarrersohn, Marburger Achtundsechziger
und protestierender Post-Protestant.
Friedrich-Martin Balzer zum Siebzigsten........................................................................................................ |
|
Personenregister............................................................................................................................................ |
|
Über die Autoren.......................................................................................................................................... |
|
Fenster schliessen Seitenanfang
Friedrich-Martin Balzer. "Prüfet alles, das Gute behaltet"
Von Hans See
Ich gestehe Befangenheit. Ich bin dem Autor freundschaftlich verbunden und schätze ihn sehr. Auch die Persönlichkeiten, die (so fordert es die Wissenschaft) „Gegenstände“ bzw. „Objekte“ seiner Forschung, seiner publizistischen und editorischen Arbeit sind. Wolfgang Abendroth, mit dem er sich besonders intensiv beschäftigte, war unser beider Doktorvater. Daher glaube ich sagen zu dürfen, dass allein das, was Balzer mit der Erstellung seiner Abendroth-Bibliographie geleistet hat, ihm einen festen Platz nicht nur unter marxistischen Sozialwissenschaftlern, Historikern, linken Gewerkschaftern und friedenspolitisch engagierten Bürgerinnen und Bürgern sichern wird.
Balzer hat etwa 40 Bücher publiziert. Sein überwiegendes Interesse gilt „zukunftsweisenden Gestalten der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert“. Die wichtigsten Namen finden sich auf der inneren Titelseite. Der politischen Linken Deutschlands werden sie – hoffentlich – noch vertraut sein, aber kaum deren Leben und Lebenswerk. Das liegt an der Geschichte. Sie hat äußerst wertvolles Wissen, wertvolle Erfahrungen und die Erinnerung an die politischen Kämpfe dieser „Gestalten“ gegen Pseudodemokraten, Faschisten und Kriegstreiber wie meterdickes Steingeröll unter sich begraben.
Balzers Lebenswerk und Lebenslust besteht nun gerade darin, diese verschütteten Schätze zu bergen und den Nachgeborenen zu überliefern. Er prüft alles sehr genau. Das Gute und Richtige sichert er für die Kämpfe der kommenden Generationen. Allzu bescheiden nennt er seine Arbeit „Spurensuche“. Mir, ich las in meiner frühen Jugend Karl May, fällt dabei der edle Wilde Winnetou ein. Der aber interessierte sich fast nur für die Spuren seiner Feinde. Der "Spurensucher" wird deshalb allenfalls dem antifaschistischen Friedenskämpfer Balzer gerecht. Ich fände es aber zutreffender, wenn er sich als „Schatzsucher“ sähe. Mir fällt Heinrich Schliemann (1822 bis 1890) ein, der Ausgräber des durch Lug und Trug besiegten Troja, auch wenn beide, außer, dass man sie als erfolgreich nach Schätzen suchende Pfarrersöhne sehen darf, wenig gemein haben. Balzer hebt und sichert die Erfahrungen und Schriften nicht nur von Wolfgang Abendroth, sondern auch von Erwin Eckert, Emil Fuchs, Kurt Julius Goldstein, Hans Heinz Holz, Eric Hobsbawn, Robert Neumann, Helmut Ridder und Wolfgang Ruge.
Zu Balzers ersten geborgenen Schätzen gehört die Geschichte des protestantischen Pfarrers Erwin Eckert, der – was ja nun wirklich eine historische Wegmarke war – Mitglied der KPD wurde. Eckert wie andere Gestalten, die vor allem von christlichen Antikommunisten ihrer Ehre und Würde beraubt wurden, betrachtet und behandelt Balzer so, als hätte die UNESCO sie zum geistigen Kulturerbe des 20. Jahrhunderts erklärt. Mit eindrucksvollen Studien, Essays, Erinnerungen, Reden, die Balzer für dieses Buch zusammenstellte, führt er seine Leserinnen und Leser durch die Erlebnis- und Ergebniswelt seiner wissenschaftlichen, publizistischen und friedenspolitischen Arbeit. Es ist eine Zwischenbilanz seines bisherigen Schaffens.
Das Buch bietet spannende Rück- und Einblicke in die politischen Kämpfe der Nachkriegsgeschichte und man begreift plötzlich so klar wie selten, dass diese Geschichte von den besiegten Verbrechern und den sich mit diesen arrangierenden Siegermächten geschrieben wurde.
Übrigens: Erstmals veröffentlicht Balzer seine Streitschrift: „Die Mitverantwortung des deutschen Protestantismus für Faschismus und Holocaust.“ Hier zeigt er, wie sich die von ihm vor dem Vergessenmachen geretteten Schätze für eine zukunftsorientierte Wissenschaftspraxis fruchtbar machen lassen. Menschen, die sich für die Geschichte der Symbiose von Marxismus und Christlichkeit interessieren, werden mit den von Balzer geborgenen Kulturschätzen reichlich beschenkt. Ein großartiges Buch, das weit über die Grenzen der Kritik der politischen Ökonomie hinausweist, leider nicht so weit, dass das theoretische und praktische Defizit in Sachen „kriminelle Ökonomie“, das viele Niederlagen marxistischer Sozial- und Friedenspolitik erklärt, bewusst werden könnte. Aber dies ist ein anderes Thema.
Es fällt allerdings im Kontext eines solchen Bandes besonders stark auf, dass die Linken in der Vergangenheit und – trotz inzwischen hinreichender Erkenntnisse über die auch in den realsozialistischen Ländern vorhanden gewesenen kriminellen Wirtschaftspraktiken – noch immer keinen systematischen Ort für dieses Phänomen in ihren Programmen und Theoriekonzepten gefunden haben. Dennoch gehört dieses Buch in einem erweiterten Sinne zum Themenkreis krimineller Ökonomie, denn es enthält kaum einen, in dem nicht zumindest die Verbrechen der NS-Regimes direkt oder indirekt thematisiert werden. Dass der Kapitalismus auch ohne Wirtschaftskriminelle eine Gefahr für Mensch und Natur, Demokratie und humanistische Kultur ist, dafür steht dieser Band. Damit bietet er aber auch eine wichtige Voraussetzung, die Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie weiter auszubauen und zu einer Kritik der kriminellen Ökonomie weiter zu entwickeln, die allerdings auch für künftige sozialistische Wirtschaftsweisen gültig sein muss, wenn sie überzeugen soll. Hätte die historische Arbeiter- und Demokratiebewegung das Problem der kriminellen Ökonomie ernst genommen, denn es war schon Marx bekannt, hätte sie viele Irrtümer und Irrwege vermeiden können. Mit ihr könnte ein wirklich demokratischer (nein, kein sozialdemokratischer) Sozialismus neue Kräfte entfalten und eine neue Zukunftsperspektive gewinnen.
In: Hans See in BIG Business Crime, Vierteljahresschrift Theorie, Praxis und Kritik der kriminellen Ökonomie, 1/2011, S. 46.
Fenster schliessen Seitenanfang
Es bleibt das intellektuelle Sich-nicht-abfinden
Dieses Buch ist das Selbstportrait des Autors und Herausgebers Balzer. Ein Selbstportrait, wie es ein Maler erstellen kann, indem er andere portraitiert. Wobei diese Portraits keine Auftragsarbeiten sind, sondern Portraits von Personen, die dem Autor/Maler sympathisch sind, an denen er genug eigene Züge entdeckt und durch Buch/Malerei einem allgemeinen Publikum präsentiert.
Diese Art der Erstellung von Portraits mit dem Nebeneffekt des Selbstportraits wird mit großer Sorgfalt, mit pedantischer Akribie betrieben. Übrigens sind die Portraitfotos (etwa 20) in diesem Band ebenfalls von hoher Ausdruckskraft.
Die Personen, die Balzer dem Leser bekannt macht, sind bis auf Eric Hobsbawm wohl nur wenigen Lesern bekannt. Sie gehören alle zu einer winzigen Schicht von Intellektuellen (überwiegend Hochschullehrer, Pfarrer, Publizisten), die sich in prinzipieller Ablehnung des Kapitalismus befanden und diese Position lifelong beibehalten haben.
In ihrer prinzipiellen Opposition, die sich auch unter z. T. massiver Verfolgung oder Ausgrenzung bewährte, sind sie (und damit auch Balzer) dem Problem ausgesetzt, dass es keine breiten gesellschaftlichen Bewegungen (wie die Arbeiterbewegung oder auch bestimmte religiöse Bewegungen) mehr gibt, die eine alternative Gesellschaft erstreben. Es bleibt, lässt man die Einzelporträts auf sich wirken, eine erstaunliche Breite und Tiefe von Argumenten des Sich-nicht-abfindens mit dem Kapitalismus. Träger sind aktuell allerdings kleine Gruppen von Intellektuellen. Solange die Strukturprobleme des Kapitalismus wieder massiver an die Oberfläche dringen, besteht aber prinzipiell die Möglichkeit, dass intellektuelle Funken überspringen.
In trockener Sprache ist hier intellektuelles Feuerwerk sorgfältig verpackt.
Kurzrezension von Dietrich Marquardt in amazon.de
Fenster schliessen Seitenanfang
Antifaschisten. Eindrucksvolle Porträts
Von Günter Brakelmann
Es ist für die Erforschung der kirchlichen Zeitgeschichte gut, dass es Autoren gibt, die gegen das Vergessen derer anschreiben, die im Raum des Protestantismus mit ihren intellektuellen Analysen und in ihrem praktisch politischen Verhalten konsequente Gegner des Nazismus waren. Zu diesen Autoren gehört seit Jahrzehnten der Marburger Friedrich-Martin Balzer. Die Einleitung seiner Aufsatzsammlung von Hans Heinz Holz zeigt, welche Bedeutung Balzer in der linken Szene zukommt. Und das Nachwort von Manfred Gailus ist der Versuch, dem „Iserlohner Pfarrersohn“‚ „Marburger Achtundsechziger“ und „protestierenden Post-Protestanten“ gerecht zu werden.
Balzer zeichnet eindrucksvolle Porträts der mit ihm befreundeten Wolf gang Abendroth, Hans Heinz Holz, Helmut Ridder und anderen Denkern Aber auch zwei Theologen, die als Religiöse Sozialisten vor und nach der Machtübergabe an Hitler gegen den Geist und die Praxis des Nationalsozialismus gekämpft haben, werden porträtiert Erwin Eckert und Emil Fuchs. Es ist Balzers Verdienst dass er in gründlicher Kennerschaft der zeitgenössischen Texte der NS-Gegner auf eine Lücke in der traditionellen Kirchengeschichtsschreibung hinweist, die sich immer mehr als wissenschaftlicher Skandal erweisen dürfte: die Geringschätzung des linken Protestantismus in der Kirchengeschichte.
Der aufregendste Beitrag von Balzer dürfte, in Aufnahme seiner älteren Forschungsergebnisse, eine „Streitschrift“ mit dem Titel „Die Mitverantwortung des deutschen Protestantismus für Faschismus und Holocaust“ sein. Für mich ist sie eine notwendige Provokation gegenüber einer Kirchengeschichtsschreibung, die sich immer noch weigert, die historische Mitverantwortung des Kirchen und Milieuprotestantismus für das Aufkommen und die Stabilisierung des NS-Systems wie für die mehrheitliche Bejahung der Innen‚ Außen- und Kriegspolitik Hitlers quellengerecht darzustellen, die immer noch die Bekennende Kirche (BK) in die Nähe einer Widerstandsbewegung bringen und nur die Deutschen Christen als nazistisch orientierte Kombattantengruppe als Häretiker und Irrläufer qualifizieren will.
Balzer unternimmt einen Streifzug durch die Jahre 1930 bis 1945, um zu zeigen, dass der Mehrheitsprotestantismus eine klare politische Nähe zum Hitlerstaat hatte. Die Quellen sprechen hier eine eindeutige Sprache und entlarven die späteren Selbstdarstellungen der BK und die in ihrem Gefolge stehende Geschichtsschreibung als Apologie, bis hin zur Vertuschung der Mitverantwortung für Hitlers System und vor allem für seinen Krieg gegen den Bolschewismus. Dass Balzer demgegenüber die „Christlichen Antifaschisten der ersten Stunde: Erwin Eckert, Emil Fuchs und Heinz Kappes“ ihren historischen Rang geben will, ist berechtigt, und dass er führende Männer des Kirchenapparates vor und nach dem Krieg als hochproblematische Zeitgenossen darstellt, ist notwendig, um von dem Mythos eines kirchlichen Widerstands Abschied zu nehmen und sich den wirklichen Antifaschisten zuzuwenden.
Die Streitschrift will provozieren. Das heißt, sie lädt ein zum kritischen Dialog mit anderen Positionen. Die kirchenhistorische Zunft sollte dieses Angebot eines kirchenkritischen Protestanten annehmen.
In: zeitzeichen 9/2011, S. 66
Fenster schliessen Seitenanfang
Spurensuche
Von Thomas Metscher
Friedrich-Martin Balzer hat ein ungewöhnliches, hochwichtiges Buch vorgelegt. Es ist ein Buch der Spurensuche, angeschrieben gegen das organisierte Vergessen. Es handelt von Menschen, deren Werk und Wirken erinnert werden muß, wenn die Zukunft nicht so trostlos bleiben soll wie sie jetzt oft erscheint.
Balzer, Abendroth-Schüler und vom Beruf her Lehrer, war von frühen Jahren an ein leidenschaftlicher Sammler. „Ausgraben und aufbewahren“ war und ist, wie Georg Fülberth in einer Würdigung zu seinem siebzigsten Geburtstag schrieb, das Thema seines Lebens –, dem Gedächtnis der „namenlos Gemachten“ gewidmet, „die in ihrer Zeit widerständig waren und ein riesiges Erbe von Gedanken und nachahmenswerten Taten und Handlungen hinterließen“ (Junge Welt vom 24. November 2010).
Ein Mittelpunkt dieser Erinnerungsarbeit ist der christliche Kommunist Erwin Eckert, ehemals Vorsitzender des Bundes religiöser Sozialisten, von seiner Kirche aus dem Pfarramt gejagt, als er die SPD verließ und in die KPD eintrat, eingesperrt von den Nazis, unter Adenauer verurteilt als Aktivist der Bewegung gegen die Wiederbewaffnung, der populärste westdeutsche Kommunist nach Max Reimann in den Jahren 1945-49 – über den Balzer bei Abendroth promovierte, über den er viele Bücher produzierte, dessen Nachlaß er sicherte und verwaltet. Es sind solche in Vergessenheit Geratene, denen Balzers Spurensuche gilt: Emil Fuchs, Kurt Julius Goldstein, Robert Neumann, Wolfgang Ruge sowie Unbekannte wie Helge Speith. Daneben aber stehen durchaus bekannte, ja weltbekannte Namen: Eric Hobsbawm, Wolfgang Abendroth, Hans Heinz Holz, Helmut Ridder; mit Editionen, elektronisch erfaßten Gesamtbibliographien als Grundlage weiterer Forschungen, in der Erfassung nicht zuletzt auch wenig bekannter oder als verloren gegoltener Schriften. So behandelt Balzer Hobsbawms frühe publizistische Arbeiten zur Literatur, Holz’ höchst umfangreiches, den universalistischen Zug seines Denkens beeindruckend dokumentierendes publizistische Werk, die Vita des frühen Abendroth (seine Rolle im griechischen Widerstand), die, außerhalb des Kreises seiner engsten Schüler, nach wie vor viel zu wenig bekannt ist. Ans Licht geholt werden aber auch verdrängte Seiten der deutschen Nachkriegsgeschichte: so der juristische Terror der Adenauerzeit gegen Marxismus, Kommunismus, Friedensbewegung („Der Düsseldorfer Prozeß. Die Friedensbewegung auf der Anklagebank des Kalten Krieges“), die dubiose Rolle der offiziellen Kirche unter den Bedingungen von Faschismus und Krieg in der hier erstmals veröffentlichten Streitschrift, die Hobsbawm immerhin „elektrisierend“ nannte.
Balzers Buch erschöpft sich freilich nicht als Werk der Spurensuche und Erinnerung – so unabdingbar dies für jede emanzipatorische Theorie und Praxis heute auch ist. Vieles von dem, was Balzer ins Licht rückt, ist für den Marxismus, will er als weltgestaltende Kraft zukünftig eine Rolle spielen, theoretisch wie praktisch von grundlegender Bedeutung.
Ich denke da vor allem an das Verhältnis von Marxismus und Religion – die Schwierigkeiten, die ein kommunistischer Christ wie Eckert mit Kommunismus und Kommunisten hatte (als Mensch, der auch als Kommunist gläubiger Christ blieb, ja aus dem Christentum Impulse des Handelns schöpfte). Balzer rüttelt hier an ein nach wie vor wenig erschüttertes Tabu des traditionellen Marxismus (seiner dominanten Strömungen jedenfalls). Bis heute steht ein - im Grunde metaphysischer – Atheismus dem unverkrampften Bündnis von Marxisten und Christen (wie Vertretern anderer Religionen) hindernd im Weg. Es ist dies keineswegs eine scholastische, es ist eine sehr praktische Frage. Für die zukünftige Gestaltung der Welt mag sie eine Schlüsselrolle spielen. Man denke an den Aufbruch in den lateinamerikanischen und arabischen Ländern, an die Bewegung in der islamischen Welt insgesamt. Hier gibt es einen Aufbruch von Massen, die in der großen Mehrzahl ein religiös geprägtes Bewußtsein haben (wie unterschiedlich auch immer) – für eine Theorie, die den Atheismus zum ersten Prinzip und damit zur Glaubenssache erhebt, werden sie kaum zu gewinnen sein.
Angesichts dieser Sachlage enthält Balzers Buch ein beredtes Plädoyer dafür, das Verhältnis von Marxismus und Religion zu überdenken und neu zu bestimmen – aus politischer wie aus theoretischer Notwendigkeit. Denn von der Sache her ist es höchst zweifelhaft, ob ein prinzipieller Atheismus notwendig zum Marxismus gehört. Theismus wie Atheismus bewegen sich auf der gleichen Diskursebene, der des Glaubens, die jenseits der Ebene wissenschaftlichen Wissens liegt. Auf dieser aber und nur auf dieser ist der Marxismus angesiedelt (allenfalls käme, im Sinne einer Erweiterung, noch die Ebene der Kunst hinzu). Jeden Anschein von ‚Religionsförmigkeit’, jede Vermengung von Wissen und Glauben hat er zu vermeiden, wenn er theoretisch wie praktisch eine Zukunft haben soll. Der Atheismus nun ist genau so ‚Glaubenssache’ – er ist ‚negativer’ Glaube – wie es der Theismus als ‚positiver’ Glaube ist. Der Marxismus als wissenschaftliche Theorieform liegt vor der Ebene persönlichen Glaubens; die strikte Unterscheidung zwischen beiden sollte für ihn selbstverständlich sein. Glaube spielt für ihn eine Rolle in der Form religiöser Ideologien, die je nach ihren Inhalten zu überprüfen, zu bewerten und zu behandeln sind. Der Raum für einen ‚kommunistischen Christen’ (oder Vertreter jeder anderen Religion), für eine ‚Theologie der Befreiung’, einen Glauben, der die Revolution bejaht ist also offen, von der Sache her ist hier nichts präjudiziert, vorausgesetzt, daß die Vertreter dieser Auffassung den Raum wissenschaftlichen Wissens akzeptieren und das aus wissenschaftlicher Analyse folgende politische Handeln mittragen. Für solche Überlegungen kann man sich auf Wolfgang Abendroth berufen, den Balzer in diesem Zusammenhang zitiert. So sprach Abendroth bereits in den zwanziger Jahren von den „Pfaffen des Atheismus“, die „ihr Anathema gegen alle Ungläubigen des Unglaubens schleudern“ und dadurch die christlichen Arbeiter „auf die andere Seite der Barrikade zurückdrängen“ (200). Erinnert sei, daß bereits zu Beginn des vorigen Jahrhunderts der große irische Marxist James Connolly (auch er gehört zu denen, die dem Vergessenwerden zu entreißen sind) publizistisch und politisch offensiv exakt diese Linie vertrat (vgl. Priscilla Metscher, James Connolly and the Reconquest of Ireland. Minneapolis 2001, 127-33); heute lassen sich im Denken Fidel Castros solche Auffassungen finden.
Allzu schnell wird bei den scholastischen Querelen über wissenschaftlichen Atheismus vergessen, wer der Hauptfeind ist. Es ist, wie Abendroth als „zorniger alter Mann“ 1979 formulierte, „der Monopolkapitalismus, der erst die Schande des Kolonialismus und seiner zynischen Verbrechen, dann die Barbarei zweier Weltkriege und in der Verzweiflungssituation der großen Krise nach 1929 die auch in ihrer Zielsetzung totale Inhumanität des deutschen Faschismus geschaffen hat“. Wenn wir den Hauptfeind schlagen wollen, so Abendroth, und wir müssen es, „bevor er in schlimmen inneren Widersprüchen noch furchtbarere Katastrophen für die Menschheit bewirken kann“, „dann“, so Balzer, „müssen wir allem Sektierertum eine Absage erteilen und religiös gebundene Menschen, wenn sie den Klassenkampf von unten mit dem Ziel der Verteidigung demokratischer und sozialer Rechte mitkämpfen und sich gegen Krieg und Kriegsgefahren stellen, als das ansehen, was sie sind: nicht bestenfalls nützliche Idioten, sondern gleichberechtigte Partner im Kampf für die beste Sache der Welt“ (214f.). Gibt es ein Wort von größerer Aktualität und Gültigkeit als dieses? Balzer sei Dank, daß er es, am Ende einer Parallel-Biographie von Eckert und Abendroth, uns als Aufgabe gestellt hat.
In: Marxistische Blätter, 3/2011, S.97-98.
Fenster schliessen Seitenanfang
Fundgrube der Widerstandsforschung
Von Axel Ulrich
Allen, die sich mit der Geschichte von Faschismus und Antifaschismus bzw. mit der deutschen Demokratie- und Friedensbewegung in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts befassen, dürften die zahlreichen, zumeist politisch-historisch ausgerichteten Monographien und Editionen des bekennenden Marburger „Alt-68ers“ Balzer bekannt sein. Viele davon, die inzwischen bei den Verlagen vergriffen sind, können aber zum Glück noch beim Autor direkt bestellt werden (www.friedrich-martin-balzer.de). Hierzu gehören seine bahnbrechenden Arbeiten über das antifaschistische Agieren des Bundes der Religiösen Sozialisten Deutschlands am Ende der Weimarer Republik, seine eindrucksvollen Werkeditionen und Gesamtbibliographien zu Hans Heinz Holz, Wolfgang Ruge, Gert Wendelborn, Helmut Ridder und Wolfgang Abendroth sowie das von ihm herausgegebene, um etliche Zusatzmaterialien und analytische Beiträge ergänzte Urteil im Frankfurter Auschwitz-Prozess. Auch ein 1998 erschienener, höchst informativer Sammelband „Es wechseln die Zeiten“ mit eigenen Reden und Aufsätzen aus vier Jahrzehnten gehört dazu.
Nunmehr hat der längst pensionierte Pädagoge, der als Wissenschaftler freilich heute so produktiv wie nie ist, etliche seiner seitdem veröffentlichten und einige unveröffentlichte biographische Abhandlungen sowie dazu noch ein paar autobiographische Beiträge wiederum zu einem stattlichen Auswahlband zusammengefasst, der außerordentlich vielfältige Erkenntnisgewinne beschert. Im Vordergrund stehen Arbeiten zu Balzers Hauptforschungsgebieten, nämlich dem Verhältnis von Christentum und Sozialismus, und zwar exemplifiziert an den beiden Pfarrern Erwin Eckert und Emil Fuchs, sowie der Rolle der Kirchen im Faschismus generell, wobei insbesondere seine „Streitschrift“ zur „Mitverantwortung des deutschen Protestantismus für Faschismus und Holocaust“ hervorzuheben ist.
Auch zu den ansonsten im Untertitel aufgeführten Persönlichkeiten werden durchweg bemerkenswerte Artikel gebracht. Ein Beitrag befasst sich beispielsweise mit dem berühmten britischen Historiker Eric Hobsbawn, von dem Balzer zusammen mit dem früheren Marburger Politikprofessor Georg Fülberth jüngst eine gleichfalls unbedingt empfehlenswerte Aufsatz- und Interviewedition herausgebracht hat (Zwischenwelten und Übergangszeiten. Interventionen und Wortmeldungen. Köln: PapyRossa Verlag, 2009).
Gut ein Fünftel der von Balzer jetzt präsentierten Arbeiten betreffen Wolfgang Abendroth, den Mitbegründer des Studienkreises Deutscher Widerstand. Ihre Bandbreite reicht von dessen Rolle im griechischen Widerstand gegen die faschistische Okkupation im Zweiten Weltkrieg über seine Funktion „als literarischer Ratgeber der organisierten Studentenbewegung“ in den 1960er Jahren bis hin zur Frage, inwieweit seine politisch-praktischen Analysen und Ratschläge auch noch für das 21. Jahrhundert nutzbringend sind. Balzer charakterisiert hierbei seinen lebenslang verehrten Doktorvater gewiss zutreffend als „illusionslosen, orthodoxen, kreativen wie undogmatischen wissenschaftlichen Sozialisten“. Und in der Tat war der unermüdliche Propagandist der untrennbaren Einheit von Theorie und Praxis sowie Apologet des Prinzips Hoffnung bis zu seinem Tod von der Chance eines letztendlichen Sieges der globalen Emanzipationsbewegungen zum Nutzen der gesamten Menschheit überzeugt, wofür sich jede Anstrengung lohne, selbst wenn die Grundvoraussetzungen hierfür noch so widrig sein mögen.
Eine weitere Abhandlung beschäftigt sich mit dem international renommierten Philosophen Hans Heinz Holz als Publizist. Dieser wurde bekanntlich erst Anfang der 1970er Jahre sowohl dank Abendroths unentwegter Bemühungen, als auch aufgrund der diese flankierenden, unter der Parole „Marx an die Uni“ geführten Berufungskampagne der progressiven Marburger Studentenschaft zum Hochschullehrer ernannt, und zwar entgegen heftigster inner- wie außeruniversitärer Widerstände. Auch zu Balzers neuem Sammelband hat der Gelehrte, der bis dato wohl an die 2.500 Publikationen zu philosophischen, politischen und kulturellen Fragestellungen vorgelegt hat, eine „Kleine Eloge auf einen Freund“ beigesteuert, die dessen Brillantfeuerwerk kritischer Gesellschaftsanalyse ganz vortrefflich einleitet.
Abgerundet wird die Edition durch ein kleines, aber formidables biographisches Porträt, das der Berliner Geschichtsprofessor Manfred Gailus zu Balzers 70. Geburtstag im vergangenen Jahr verfasst hat. Der Haupttitel des Buches, ein Bibelzitat, das Balzers Vater ihm 1968 als Trauspruch zugeeignet hat, hätte trefflicher nicht gewählt werden können. Es handelt sich also um eine Pflichtlektüre für alle, die gleich dem Autor couragiert für wirklich demokratische Verhältnisse eintreten.
In: Informationen Nr. 73, Juni 2011, S. 39-40
Fenster schliessen Seitenanfang
Linkes Erbe
Ein Sammelband aus Anlaß des 70. Geburtstages Friedrich-Martin Balzers
Von Ludwig Elm
Der Sammelband »Prüfet alles, das Gute behaltet« erschien anläßlich des 70. Geburtstages des Marburger Historikers und Publizisten Friedrich-Martin Balzer. Den Jubilar würdigen einleitend der Philosoph Hans Heinz Holz (»Kleine Eloge auf einen Freund«) und abschließend der Historiker Manfred Gailus (»Iserlohner Pfarrersohn, Marburger Achtundsechziger und protestierender Post-Protestant«). Einige Beiträge sind biographisch angelegt und vermitteln Erlebtes und Betrachtungen Balzers aus den vergangenen Jahrzehnten. Das betrifft Erinnerungen an die oppositionelle studentische Bewegung sowie eigene politische und publizistische Initiativen, aber auch Kritisches zur Rolle protestantischer Kirchenleitungen. Mit jeweils vier Essays werden der sozialistische Theoretiker Wolfgang Abendroth (1906–1985) und der Kommunist und Pfarrer Erwin Eckert (1893–1972) vorrangig berücksichtigt; ein bis zwei widmen sich jeweils dem Theologen Emil Fuchs (1874–1971), dem jüdischen Kommunisten und Antifaschisten Kurt Julius Goldstein (1914–2007), dem Schriftsteller Robert Neumann (1897–1975), dem Juristen Helmut Ridder (1919–2007), dem Historiker Eric Hobsbawm und Hans Heinz Holz. Dazu kommen Trauerreden Balzers auf den Sohn Erwin Eckerts, Wolfgang Eckert (2001), und dessen zweite Ehefrau, Juliane Eckert (2005). Von den 27 Beiträgen sind etwa die Hälfte Erstveröffentlichungen, die anderen erschienen zwischen 1998 und 2007.
Christ und Sozialist
Gemeinsam ist den biographischen Skizzen, daß Publizisten, Theologen und Wissenschaftler vorgestellt werden, die sich mit ihren sozialistischen, radikaldemokratischen und antifaschistischen Positionen den herrschenden Mächten, Ideologien und Politikkonzepten im bürgerlichen Deutschland entgegenstellten. Sie hatten also stets damit zu leben, daß sie im öffentlichen Diskurs angefeindet und weitgehend ausgegrenzt wurden. Seit dem Tod von Abendroth, Eckert, Fuchs, Goldstein und Ridder gilt es, zu verhindern, daß ihre Ideen und ihr Wirken dem Vergessen oder bloß ignorant-voreingenommenen Urteilen überantwortet werden. Es ist das Verdienst Balzers, daß er sich seit Jahrzehnten dieser Herausforderung gestellt hat. Immerhin geht es um ein Erbe der Linken und der Demokratie überhaupt, das in hohem Maße neben den großen Parteien und Verbänden, staatlichen Institutionen, Medien und Verlagen entstand und sich behauptete. Jahrzehntelange oder kürzere Phasen der persönlichen Beziehungen zu den genannten Intellektuellen und politischen Aktivisten beförderten das Verständnis des Autors für die Motive und vielfach widrigen Bedingungen, denen sie sich in der Bundesrepublik ausgesetzt sahen.
Mit den Beiträgen zu Eckert und Fuchs würdigt Balzer – an frühere Studien und Publikationen anschließend – evangelische Christen und hervorragende Vertreter der religiösen Sozialisten. Den Grundstein dafür hatte er mit seiner bei Abendroth verfaßten Dissertation über Eckert und den Bund der Religiösen Sozialisten gelegt. Der badische Pfarrer wirkte seit den zwanziger Jahren in der SPD und dem 1926 konstituierten Bund der Religiösen Sozialisten, darunter als Schriftleiter des wöchentlich erscheinenden Bundesorgans und geschäftsführender Bundesvorsitzender (1928–1931). Seine gesellschaftskritischen und kämpferischen antifaschistischen Positionen führten im Oktober 1931 zum Ausschluß aus der SPD und Eintritt in die KPD; es folgten der Verlust der leitenden Funktionen im Bund sowie die Entfernung aus dem Dienst der evangelischen Kirche. Ab 1933 wird der Nazigegner wiederholt und für mehrere Jahre inhaftiert. Ab 1945 ist er wiederum für seine sozialistischen und pazifistischen Ideen politisch und publizistisch aktiv. Für die KPD gehört der bekennende Christ dem badischen Landtag 1947 bis 1952 an. 1959/60 steht er erneut vor Gericht, nunmehr angeklagt als Gegner der Wiederaufrüstung und der atomaren Ausrüstung der Bundeswehr, und wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ein Bericht erinnert an den Prozeß.
Ratgeber
Mit einer auszugsweisen Dokumentation seiner Wochenberichte in Der religiöse Sozialist von 1931 bis 1933 wird Emil Fuchs vorgestellt. Diese Berichte wurden von Balzer gemeinsam mit dem Jenaer Historiker Manfred Weißbecker 2004 unter dem Titel »Blick in den Abgrund« als Quellenband veröffentlicht. Sie bilden eine lebensnahe und treffende Darstellung ausgewählter Ereignisse und Umtriebe bei der Zerstörung der Weimarer Republik durch die deutsche Rechte und ihre mächtigen Hintermänner.
Wolfgang Abendroth wird als »literarischer Ratgeber der organisierten Studentenbewegung« sowie mit seiner Rolle im griechischen Widerstand vorgestellt. Von 2006 stammt ein Vortrag, in dem Balzer eine »Parallel-Biographie« Abendroths und Eckerts zwischen 1911 und 1972 unterbreitet. Er resümierte, ihrer beider »Methoden der praktischen und theoretischen Herangehensweise an das Problem von Religion und Sozialismus sind auch heute noch aktuell«. Diese Perspektive bekräftigte er anläßlich des 100. Geburtstages von Abendroth mit dem Aufsatz »Ein Marxist des 20. Jahrhunderts auch für das 21.«. Dokumentiert wird auch Balzers Protest von Februar 2007 gegen die Verleihung der Ehrendoktorwürde des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften und Philosophie der Universität Marburg an Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Der Text enthält eine kritische Wertung der politischen Positionen und der Rolle Schmidts und bewertet seine Ehrung als Affront gegen die von Abendroth in Marburg begründete gesellschaftskritische Wissenschaftstradition.
Mit Hobsbawm, Holz, Neumann, Ridder und dem Historiker Wolfgang Ruge (1917-2006) werden Forscher und Autoren gewürdigt, die auf verschiedenen Gebieten der Philosophie, Geschichte, des Staates und des Rechtes sowie der Literatur arbeiteten und publizierten. Gemeinsam sind ihnen nichtkonformistische, radikaldemokratische und antifaschistische Überzeugungen sowie nachhaltige Wirkungen auf die oppositionellen, demokratischen Bewegungen und Richtungen. Über Ridder liest sich dies so: »Während er in den fünfziger Jahren mühelos in der Ordinarienuniversität aufstieg und zu den führenden Verfassungsrechtlern in diesem Lande gezählt wurde, geriet er in gleichem Tempo in Gegensatz zur herrschenden Politik. Die Linke hatte fortan in Helmut Ridder zunehmend einen zuverlässigen und kritischen Partner, der sich als wissenschaftlicher Politiker unbeugsam und konsequent gegen die Umdeutung demokratischer Verfassungsbestimmungen engagierte und Widerstand leistete gegen jede theoretische, legislatorische und juridische Entdemokratisierung von Gesetzen, Recht und Verfassung.«
Gegensätzliche Linien
Die Sammlung endet mit dem Aufsatz »Die Mitverantwortung des deutschen Protestantismus für Faschismus und Holocaust«. Er ergänzt folgerichtig die Studien zum konsequenten Antifaschismus religiöser Sozialisten seit den zwanziger Jahren. Nach »der Begeisterung des deutschen Protestantismus für den ersten imperialistischen Krieg 1914–1918« war das protestantische Lager mehrheitlich »aktiv an der Zerstörung der Weimarer Republik und der Errichtung und Stabilisierung der faschistischen Diktatur beteiligt«. Mit der Anpassung an den restaurativen Weg nach 1945 blieben antisemitische und pronazistische Pfarrer und Kirchenführer im Amt. Jahrzehntelang prägten sie die herrschende, apologetische Kirchengeschichtsschreibung. Es werden die gegensätzlichen Linien und Traditionen seit Anfang der dreißiger Jahre skizziert und am Beispiel des Protestantismus kritisch die Kontinuitäten nach 1945 erörtert. Gegen andauernde Halbwahrheiten heißt es: »Wer Auschwitz beklagt, sollte sich unmißverständlich auf die Seite der frühen Warner und Mahner vor 1933 und der Verfolgten nach 1933 stellen. Anders wird der Ruf ›Nie wieder Auschwitz‹ unglaubwürdig.«
Wie aktuell die Folgen unaufgearbeiteter Überlieferungen und Einsichten sind, illustrieren Aussagen des neuen Militärbischofs Franz-Josef Overbeck im Mai 2011 anläßlich seines Amtsantritts. Er bejaht die Intervention und Besatzungspolitik in Afghanistan, auch wenn »der Einsatz noch Leid und Tod auch über die deutschen Einsatzkräfte bringen« wird. Andere Opfer werden dabei ohnehin vorausgesetzt und sind hinzunehmen. Er sehe »keine Möglichkeit, sich in radikalpazifistischer Weise von diesem Einsatz zu distanzieren«. Es solle auch so bleiben, daß die deutsche Militärseelsorge eine in die Armee integrierte Organisation bleibe, in der »Bischöfe und Priester Uniform tragen und Dienstgrade haben«. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Mai 2011) Erneuter konfessioneller Rückhalt für Rüstungs- und Interventionspolitik sowie Mitwirkung an der in Deutschland so traditionsreichen Ächtung pazifistischer Ideen und Bestrebungen bedeutet, sich erneut Vorbildern und fundamentalen Lehren der Vergangenheit zu verweigern.
In: junge Welt, Nr. 206 vom 5. September 2011, S. 15
Fenster schliessen Seitenanfang
Friedrich-Martin Balzers geistige Bausteine. Antifaschistischer Bekennermut aufrechter Christen gewürdigt
Von Gert Wendelborn
Friedrich-Martin Balzer, Marburger Politologe und Historiker, legte anläßlich seines 70. Geburtstages am 24. 11. 2010 unter dem Titel „Prüfet alles, das Gute behaltet!“ eine inhaltreiche und gewichtige Sammlung seiner Aufsätze seit 1998 vor. Wir erfahren hier viel über Leben und Werk von Balzer u.a. in der verständnisvollen Würdigung durch den bürgerlichen Berliner Historiker Manfred Gailus. Hans Heinz Holz hebt im Vorwort die Treue von Balzers Überzeugung auch nach 1989 sowie seine wissenschaftliche Präzision und unbedingte Verläßlichkeit hervor.
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, den ganzen Reichtum dieses Buches vor dem Leser auszubreiten. Doch verweise ich ausdrücklich auf die tiefgründigen Ausführungen über Wolfgang Abendroth, Hans Heinz Holz, Helmut Ridder und Robert Neumann. Als Sozialist und früherer Kirchenhistoriker greife ich die Aufsätze heraus, die sich mit der neuesten Kirchengeschichte beschäftigen.
Das Lebensthema Balzers seit seiner Dissertation ist der große Religiöse Sozialist Erwin Eckert, den er so der Vergessenheit entriß. Mit Recht tritt er dafür ein, ihn als revolutionären Christen ohne Einschränkung als Bestandteil der deutschen Arbeiterbewegung ernst zu nehmen, da für diese Anerkennung einzig das Engagement für eine qualitativ neue Gesellschaft, nicht aber Glaube oder Unglaube entscheidend sein können. Eckert wurde seit 1916 aufgrund eigener Erfahrungen an der französischen Front zu einem entschiedenen Kriegsgegner. Sein Protest nahm zunehmend auch antikapitalistische Züge an. Er trat ein für ein Reich der Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Liebe. Auch im Wirtschaftsleben müßten andere Gesetze und Maßstäbe als bisher Geltung haben. Der 1. Weltkrieg wurde hauptsächlich durch internationale Konkurrenz und schrankenlose Profitgier verursacht. Pfarrer zunächst in Meersburg und dann in einer Arbeitergemeinde Mannheims, Vorsitzender des Bundes der Religiösen Sozialisten und Chefredakteur des „Sonntagsblattes des arbeitenden Volkes“, hielt er als Christ den Kampf in der Kirche gegen die Kirche für nötig, weil diese nicht selbstlos dienen, sondern herrschen wolle. Sie vergeistige die klaren Gebote Jesu, projiziere Gottes Reich ins Übersinnliche und vertröste die leidende Masse auf das Jenseits. Die Kirche müsse für alle Mühseligen und Beladenen, Suchenden und schuldig Gewordenen da sein.
Eckert wandte sich gegen den Bau eines Panzerkreuzers. Er warnte früh vor der Gefahr des Hitlerfaschismus und betonte die Unvereinbarkeit von Kreuz und Hakenkreuz. Er bemühte sich um antifaschistische Einheit auf Seiten der Linken. Als er deshalb von der SPD aus ihren Reihen entfernt wurde, schloß er sich als erster deutscher Pfarrer der KPD an und verlor sein Pfarramt. Er sprach von Oktober 1931 bis Februar 1933 vor über 100.000 Menschen.
Dankenswerterweise legt Balzer auch Eckerts schweres Schicksal in der Nazizeit offen. Dieser wurde zweimal verhaftet, 1933 zu sieben Monaten Gefängnis und 1936 zu drei Jahren und acht Monaten Zuchthaus verurteilt. Unter schwierigsten Verhältnissen brachte er seine Familie durch eine Leihbücherei in Frankfurt/Main und 1941-1945 als Angestellter mehrerer Industriebetriebe durch, bewahrte den Zusammenhalt mit anderen Antifaschisten und half Zwangsarbeitern.
Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus suchte er in der französischen Besatzungszone eine einheitliche Linke aufzubauen, wurde Mitglied der ersten südbadischen Landesregierung, war Lizenzträger einer antifaschistischen Illustrierten, bis 1949 südbadischer KPD-Vorsitzender und von 1947 bis zum Verbot der KPD 1956 Landtagsabgeordneter. 1949 erhielt er bei der Wahl des Mannheimer Oberbürgermeisters 34,7% der Stimmen. Seine Wahl konnte nur durch ein Bündnis der SPD mit allen bürgerlichen Parteien verhindert werden. 1959/60 stand er als Mann der westdeutschen Friedensbewegung und Vizepräsident des Weltfriedensrates in Düsseldorf erneut vor Gericht. Seinen Lebensabend verbrachte er bis zu seinem Tod 1972 unter kümmerlichen Umständen, aber ungebrochen und in den Reihen der DKP wirkend.
Ich kann hier nicht in gleicher Ausführlichkeit über Emil Fuchs sprechen, doch weise ich auf dessen innen- und außenpolitisch akzentuierte Wochenberichte im Bundesorgan der Religiösen Sozialisten 1931-1933 hin, die sich durch ihren Faktenreichtum und ihre tiefschürfende Analyse mit klarer Sprache auszeichnen. Sie deckten den schleichenden Prozeß der Aufhebung demokratischer und sozialer Bürgerrechte auf und traten unentwegt für antifaschistische Einheit ein. Leider wurden diese Berichte auch in der DDR nicht zur Kenntnis genommen.
In absolutem Gegensatz hierzu standen die offiziellen Kirchen, wie Balzer mit einem erdrückenden Tatsachenmaterial darlegt. Ihre Beteiligung an Faschismus, Krieg und Holocaust war kein Betriebsunfall, sondern das Ergebnis eines langen Irrweges. Auch nach 1945 gab es in den Kirchen keine wirkliche Entnazifizierung. Faschistisch belastete Pfarrer wurden anders als Eckert wieder in den Kirchendienst übernommen. Die meisten Bischöfe nannten 1933 das „Dritte Reich“ ein Geschenk und Wunder Gottes. Ein Hirtenbrief der badischen Landeskirche behauptete z.B., das deutsche Volk sei aus lähmendem Todesschlaf erwacht, also auferstanden. Nach den Morden am 30. 6. 1934 hieß es, Hitler habe mit bewundernswerter Tatkraft hochverräterische Machenschaften beseitigt. Der Thüringer Landesbischof Martin Sasse meinte nach den Judenpogromen vom 9.11.1938, die Macht der Juden sei nun endgültig gebrochen und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt worden. Zu Hitlers 50. Geburtstag im April 1939 sprach z.B. der badische Bischof von bedingungsloser Gefolgschaftstreue und ließ alle Kirchenglocken läuten. Dr. Friedrich Werner als Leiter der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei verlautbarte zum Beginn des 2. Weltkrieges, die Kirche reiche zu den Waffen aus Stahl unüberwindliche Kräfte aus Gottes Wort. Ein bayerischer Pfarrer schlug 1942 in einem Brief an Julis Streicher sogar vor, für jeden durch alliierte Bombenangriffe getöteten deutschen Zivilisten 10 Juden aufzuhängen. Der Vertrauensrat der DEK erklärte in einem Telegramm an Hitler am 30. Juni 1941 nach dem Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion: „Sie haben, mein Führer, die bolschewistische Gefahr im eigenen Lande gebannt und rufen nun unser Volk und die Völker Europas zum entscheidenden Waffengang gegen den Todfeind aller Ordnung und aller abendländisch-christlichen Kultur auf.“ Unsere unvergleichlichen Soldaten gingen nun mit gewaltigen Schlägen daran, diesen „Pestherd“ zu beseitigen.
Das muß nicht kommentiert werden. Meine Zeilen wollten aber darlegen, daß progressive und reaktionäre Traditionslinien der Kirchengeschichte in nicht aufzulösendem Gegensatz stehen und dies auch noch heute. Christen aber, die an der Seite der revolutionären Kräfte auch persönliche Opfer und selbst Verfolgungen nicht scheuen und als Bundesgenossen im Vollsinne in ihre Reihen aufgenommen werden, danken Friedrich-Martin Balzer dafür, daß er für diese Aktionseinheit wichtige geistige Bausteine bereit stellt. Sein Buch gehört in die Hand all derer, die für die beste Sache der Welt kämpfen.
In: RotFuchs 8/2011, S. 23.
Fenster schliessen Seitenanfang
„Prüfet alles, das Gute behaltet“
Von Robert Steigerwald
Friedrich-Martin Balzer hat diese Worte als Titel und Motto zu seinem neuen Buch gewählt. Mir drängt sich die Frage auf: Wie kann man solch ein Buch besprechen? Gut 30 Beiträge unterschiedlicher Art sind hier versammelt. Im Mittelpunkt steht fast immer eine Persönlichkeit, von Eric Hobsbawn absehend kamen sie alle aus unserem Land. Dazwischen eingefügt sind u.a. soziologische Aufsätze, Prozessberichte, Einblicke in Gefängniszeiten, kurzum: Eine bunte Palette. Aber es gibt im Buch einen Roten Faden: Es geht in jedem einzelnen Fall um Parteinahme gegen Krieg, Faschismus, deren ideologische Rechtfertigung oder kirchliche Beweihräucherung – und den sich dagegen richtenden entschiedenen Widerstand gerade auch im Rahmen kirchlicher Existenz. Das Buch ist so ein die Geschichte der Evangelischen Kirche begleitendes Werk. Eine im Wesentlichen für wirkliche Christen beschämende Geschichte des Missbrauchs von Religion. Denn man darf Kirche und Religion nicht in einen Topf werfen. Als Organisation in der Klassengesellschaft ist die Kirche Dienstmagd der Herrschenden. Religion aber ist Sache der Herrschenden nur, sofern sie dazu dient Herrschaft und Ausbeutung mit dem Heiligenschein der Religion zu umgeben. Die Religion selbst ist keine Organisation, sondern gehört – im marxistischen Sprachgebrauch – dem Bereich des Ideologischen an und ist insofern klassenübergreifend. Da schließt sich etwas an, das ich von Erwin Eckert gelernt habe: Als ich einmal von religiösem Sozialismus sprach, unterbrach er mich und sagte. Es gibt religiöse Sozialisten, aber keinen religiösen Sozialismus. Der ist weder religiös noch a-religiös, religiös können Christen wie Nicht-Christen sein, aber es gibt nur einen Sozialismus und der ist weder christlich noch kapitalistisch.
Ich habe die Freunde und Genossen, von denen im Buch die Rede ist, bis auf Hobsbawn, Robert Neumann und Helge Speith alle persönlich kennen gelernt, und solche Begegnung hat fast immer „abgefärbt“
Es war noch in meiner Zeit als SPD-Mitglied, es muss um das Jahr 1946 gewesen sein. Landtagswahl in Hessen. Versammlung der als zwar auch schon nicht mehr marxistischen SPD, aber offiziell hat sie den erst 1947 in der Ziegenhainer Erklärung (kennt hier keiner!), nicht erst später in Godesberg, zum Fenster hinausgeworfen. Im Wahlkreis Fulda, diesem katholischsten Kreis Deutschlands, kandidierte für die SPD Emil Fuchs, ein evangelischer Pfarrer! Der erzählte uns, wie man ihn in seinem Wahlkreis auf die Pelle rückte, wie er, der Pfarrer, dazu komme, für die Roten, diese Gottesfeinde zu kandidieren. Und er? Er versuche seinen Kritikern klar zu machen, dass er es gerade als Christ, als Pfarrer für seine Pflicht hielte, den Armen und Bedrängten zur Seite zu stehen, grade auch wenn Wahlen anstünden. Mich, den Nicht-Religiösen, den, der nicht gut auf die Kirchen zu sprechen war, hatte das damals sehr beeindruckt. Und es war dies nicht das einzige derartige Erlebnis. Nördlich von Bremen, in Nordenham, hatte sich eine CDU-Ratsfrau aktiv in die Kräfte eingereiht, die gegen das Berufsverbot wirkten, sie hat unseren nicht immer sehr zuverlässig arbeitenden Genossen gar manches Mal richtig den Marsch geblasen. Ich könnte davon noch lange erzählen. Jedenfalls ist mir seit damals der aktive, am Kampf gegen Faschismus, Rassismus, Krieg und Ausbeutung beteiligte Christ, der Genosse, im Unterschied zu so manchem meiner Parteibuch-Genossen, die sich eher als politische Blindschleichen verhalten.
Dies vorweg: Wir haben in der DKP, wenn jemand zu uns kommen wollte, nicht danach gefragt, wie er oder sie es mit der Religion halte, ob er oder sie aus der Kirche ausgetreten sei. Uns interessierte, wie er oder sie zu Programm und Politik der Partei sich verhalte. Und da fällt mir eben Erwin Eckert ein, der natürlich im Zentrum des Buches von Balzer steht (und die Totenrede zu Eckert habe ich im Auftrage der Partei gehalten, habe ihn während der letzten seiner Lebensjahre ebenfalls im Auftrage der Partei betreut). Eckert war genau so Kommunist wie ich. Er war trotz Rauswurfs aus dem Kirchenamt und Entzug des kirchlichen Ruhegehalts treuer evangelischer Christ geblieben. Er, der 1946-1949 auch schon Vorsitzender der KPD in Baden gewesen war.
Solche Lebensläufe gibt es in großer Zahl, und einige davon sind Thema in Balzers Buch: Eben Emil Fuchs, andere etwa Wolfgang Abendroth oder Helmut Ridder, auch Hanfried Müller und Rosemarie Müller-Streisand. Ich stimme Thomas Metscher zu, wenn er in seiner Rezension dieses Buches (in den „Marxistischen Blättern“) gegen stur-dogmatische Religionsfeindschaft schreibt, bin aber aus Kenntnis der Partei der Meinung, dass die gemeinsamen Kämpfe von Kommunisten und Christen etwa in den Ostermärschen, im Kampf gegen die Notstandsgesetze usw. Genossen, sofern sie jemals primitiv-dogmatischer Anti-Religiosität gehuldigt haben sollten, sich von solcher stur-dogmatischen Christenfeindschaft abgewandt haben – und das (nicht nur das) unterscheidet uns sehr von Leuten des primitiven bürgerlichen Anti-Klerikalismus oder des Evolutionären Materialismus etwa Schmidt-Salomons.
Balzers Beiträge haben auch mit historischen Wurzeln zu tun, die Kommunisten und ihre christlichen Mitstreiter gemeinsam haben: Da geht es um die Französische Revolution und den Roten Oktober, um die Widerspiegelung beider Großereignisse in den „Wochenberichten“, die Emil Fuchs im Bundesorgan der Religiösen Sozialisten 1931-33 geschrieben hat. Das waren Texte, die auch heute noch nichts an ihrer Bedeutung verloren haben. Wie es überhaupt frappierend ist, wie vieles von dem, was uns heute bürgerliche Politiker und Medien als dem arbeitenden Volk dienlich verteidigen aber nur der Steigerung oder wenigstens der Sicherung der Ausbeutung dienen, schon damals wort-wörtlich gleich gelautet haben: Es geschieht nichts Neues unter der Sonnen!
In: Unsere Zeit, Nr. 33 vom 19. August 2011, S. 15.
Fenster schliessen Seitenanfang