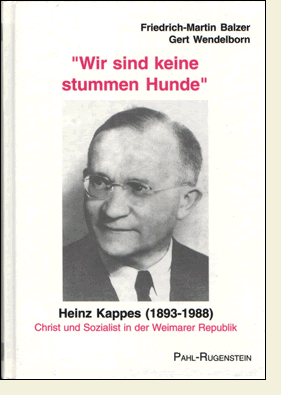| |
|
|
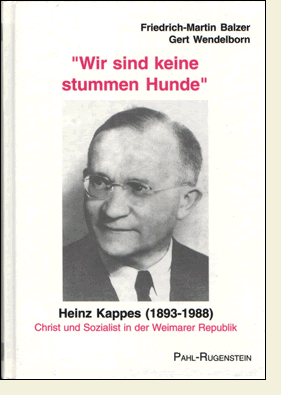
Warum ein „roter“ Pfarrer bei den Nazis in Ungnade fiel. Kirchenmann, Sozialist, schließlich Esoteriker: Heinz Kappes.
„Christ und Sozialist in der Weimarer Republik“ (so der Untertitel des Buchs) war dieser Heinz Kappes, der am 1. Mai 1988 „weiterging“. Weitergehen nannte der Pfarrer und Politiker das Sterben, und als ein Weitergehen in immer andere Stadien des Daseins praktizierte Kappes schon früh seine abenteuerliche, 94 Jahre währende Wanderschaft.
Sie begann im badischen Fahrenbach am 30. November 1893. Der Vater war Pfarrer und Kirchenrat, und auch Heinz Kappes übernahm schon 1923 nach theologischen Studien in Tübingen und Berlin seine erste Pfarrei. In Karlsruhe wurde er Jugendpfarrer.
Als Heinz Kappes ein Jahr zuvor sein Vikariat in der Karlsruher Schloßkirche begonnen hatte, zog er sich, gleich bei der ersten Predigt, den ersten, doch nicht letzten Rüffel der Kirchenleitung zu. Er hatte das Gleichnis vom barmherzigen Samariter mit dem Wirken der zeitgenössischen Gewerkschaften verglichen.
Friedrich-Martin Balzer und Gert Wendelborn dokumentieren in ihrer Biographie über Heinz Kappes diese unsteten Jahre der Weimarer Republik. Mit unveröffentlichtem und ausführlichem Quellenmaterial, mit Predigtabschriften und Korrespondenz sowie einem abschließenden Kapitel mit fast stichwortartig kurzen Hinweisen auf Kappes Leben nach seinem späteren Berufsverbot beendet das Autorenteam diesen längst fälligen Bericht über ein unbekanntes Christenleben.
Ein außergewöhnlicher Mensch und ein ungewöhnliches Schicksal breiten der Lehrer Balzer und Wendelborn, emeritierter Professor für Kirchengeschichte, aus. Der SPD-Stadtrat Kappes wurde schließlich vom Karlsruher Oberbürgermeister aller seiner Ämter in Kommissionen und Ausschüssen „entpflichtet“, wenig später folgte die Landeskirchliche „Zurruhesetzung“, als Kappes sich weigerte, seinen Weg als „religiösen Sozialisten“ als Irrweg zu bezeichnen, erhielt der 4ojährige Pfarrer nach der nationalsozialistischen Machtergreifung, von den Kirchenbehörden das endgültige Berufsverbot.
Im aktuellen Kirchenkampf auf der Kanzel bezog er damals so mutig seine Positionen wie beim Engagement für Arbeitslose und Kinder und Jugendliche. Er beschaffte „Notstandsherbergen“ durch die Stadt, er richtete „Stadtranderholungen“ für die unterernährten Kinder der Nachkriegszeit ein. Und er versäumte in seinen „sozialistischen Gottesdiensten“ nicht darauf hinzuweisen, daß das Reich Gottes nicht mit dem Sozialismus verwechselt werden dürfe.
Während des Zweiten Weltkrieges in Palästina, wohin Kappes 1935 vor den Nationalsozialisten emigrierte, verdiente er für sich und seine Familie den kümmerlichen Unterhalt mit Deutschunterricht. Nachdem er 1948 in die Heimat zurückgekehrt und als Religionslehrer im Schuldienst beschäftigt war, brachte er konservative Eltern gegen sich auf. Er hatte kompromißlos für die christlich-jüdische Zusammenarbeit geworben.
Während seiner Amtszeit als Leiter des Evangelischen Gemeindedienstes in Karlsruhe, von 1952 an bis zur Pensionierung, begründete Kappes die Bewegung der Anonymen Alkoholiker in Deutschland. Deren Schriften hatte er in Amerika kennengelernt, als er seine dort lebenden Kinder besuchte. Als adoptierter Alkoholiker hielt er zwei Jahrzehnte lang seine zur Nüchternheit anregenden Reden.
Gleichwohl durchdrangen nun mystische Neigungen sein Leben. In einem Jerusalemer Antiquariat hatte er 1944 „Das Göttliche Leben“ des zunächst als militanter Freiheitskämpfer, später als Religionsphilosoph wirkender Sri Aurobindo entdeckt. Nach seiner Pensionierung lebte Kappes zehn Monate lang in Aurobindos Ashram. Und während Kappes weitere drei Jahrzehnte lang „Seelsorger“ für Alkoholiker und psychisch Kranke bleiben sollte, übersetzte er Aurobindos Werk ins Deutsche.
In die aktive Politik wollte Heinz Kappes nicht mehr zurückkehren. Politik, die Arbeit für die Gemeinschaft, wurde ihm zum Dienst am Nächsten. Seine in der Weimarer Republik an die äußeren Obrigkeiten gerichteten Worte „Wir sind keine stummen Hunde“ wendete Kappes auf den privaten Raum an.
Wer in den letzten dreißig Jahren seines Lebens in seine Studierklause kam - und es waren Hunderte von Ratsuchende, denen der stets freundliche, ausgeglichene Mann die Tür öffnete -, wurde auf andere Obrigkeiten verwiesen. Heinz Kappes unterstützte sie im Kampf mit den inneren Tyrannen. Aus dem christlichen Sozialisten wurde eine soziale Institution. Alexandra Glanz in: Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 27.1.1995
Sie waren keine stummen Hunde! Zunächst zum Buchtitel: er erklärt sich aus der Überschrift eines Beitrags von Kappes für eine sozialdemokratische Zeitung. Darin setzt er sich mit dem kirchenamtlichen Kesseltreiben gegen Erwin Eckert auseinander. Mir scheint, der Buchtitel sei treffend geeignet, das Wirken solcher Persönlichkeiten wie Kappes und Eckert zu kennzeichnen.
Die beiden Autoren sind seit Jahren am Werk, um das Leben und Arbeiten bedeutender Persönlichkeiten aus dem deutschen Protestantismus zu würdigen, die sich als Christen engagiert für den Sozialismus einsetzten. Insbesondere geht es dabei um Erwin Eckert und nun auch um Heinz Kappes, die übrigens beide im gleichen Jahr geboren wurden.
Das sehr schön - auch in typografischer Hinsicht beurteilt - aufgemachte Buch enthält einleitend den Beitrag Balzers über die auffallenden Parallelen im Leben und Wirken von Eckert und Kappes, sodann in der Darstellung seines Lebenslaufes die Schilderung von Kappes Wirken durch Wendelborn und schließlich einen umfangreichen Dokumententeil, dazu eine Reihe Fotos.
Die aktuelle Bedeutung des Buches ergibt sich nicht daraus, daß sich eine solche Bewegung wie jene der religiösen Sozialisten der Weimarer Republik wiederholen könnte, die Autoren sagen ausdrücklich, daß dies nicht geschehen werde. Aber das Wirken um die sozialen Menschenrechte bleibe ein Postulat christlicher Nächstenliebe, und zwar im weltumfassenden Sinn. Es gehe um Frieden, um reale Demokratie in Staat, Kirche und Gesellschaft, um Humanität, wie sie sich im Kampf gegen Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus ausdrücke. Dies im Wirken der religiösen Sozialisten treibende Motiv sei heute aktueller denn je. Dabei waren die religiösen Sozialisten, insbesondere einige ihrer führenden Persönlichkeiten, keine bequemen Zeitgenossen. Sie suchten den Konflikt mit Kirchenführern, für die Religion tatsächlich das war, was Marx fälschlicher Weise in den Mund gelegt wird: „Opium für das Volk“, Beruhigung über das reale Elend, Vertröstung auf Erlösung in einem imaginären Jenseits, um den Herrschenden jene Ruhe zu sichern, die sie für die Vorbereitung und Durchführung ihrer unheilvollen Politik brauchten. Erschütternd und empörend zugleich ist der Text jenes Hirtenbriefes des Badischen Oberkirchenrates, der am 2. April 1933 von der Kanzel herab den Machtantritt der Nazis feiert (der Hirtenbrief ist faksimiliert auf den Seiten 102ff abgedruckt). Und ebenso beeindruckend ist die Antwort der Pfingstpredigt von Heinz Kappes (auf S. 224ff abgedruckt): Er sah „mit Angst in drohende Katastrophen“, „den Satan triumphieren“, „ein Totenfeld, wo heute neues, starkes Leben zu sein scheint“ (S.226).
Mich haben die Dokumente noch mehr gefesselt als die beiden einleitenden Arbeiten, dies vor allem wegen der unglaublichen Aktualität mancher Auseinandersetzungen. Aber wichtig sind doch auch die beiden einleitenden Beiträge, weil sie nicht unkritisch auf Positionen etwa von Kappes eingehen. Kappes hat sich in einer ausführlichen Ausarbeitung zum Marxismus bekannt (S. 210ff). Dies geschah in der Polemik gegen einen Kirchenmann, dem Kappes mit großer analytischen Kraft nachweist, daß er über Dinge redet, von denen er nichts oder nicht genug weiß. Das Studium der Ausarbeitung bestätigt den Kommentar Balzers, daß der Marxismus-Begriff von Kappes sich nicht deckt mit einem Begriff von Marxismus, der auch das Ganze des Wesentlichen am Marxismus umfaßt. Es ging Kappes vor allem um die ökonomische und Klassenkampf-Theorie Marxens - und er wendet sie mit großem Geschick in der Analyse der damaligen Zeit, insbesondere der Krisenprozesse, an (Beiträge „Jugend ohne Hoffnung“, S.215ff, „Wir und die sozialistische Jugend“, S. 172ff), sodann um die materialistische Geschichtsauffassung, wobei er die christliche Religion - und dem würde ein marxistischer Verfechter der materialistischen Geschichtsauffassung nicht zustimmen - aus dem Bereich des ideologisch-politischen Überbaus ausklammert. So meinte er, die geistigen Schöpfungen seien, im Unterschied zu den gesellschaftlichen, nicht abhängig von den materiellen Lebensbedingungen (S.214). Wendelborn macht darauf aufmerksam, daß hier gewisse Tendenzen einer Rückwendung, vom wissenschaftlichen zum utopischen Sozialismus erkennbar waren (S.64).
Durch alle Dokumente, durch das ganze Buch, zieht sich der Kampf der religiösen Sozialisten, ihrer Wortführer, gegen jene konservativen Kirchenmänner, die sich eigentlich im Lichte der späteren Ereignisse als regelrechte Steigbügelhalter der zur Macht drängenden Nazis erwiesen haben. Und wie schon im Falle Eckert, so hat sich auch im Fall von Heinz Kappes diese konservative, deutsch-nationale, präfaschistische Kirchenführung „tapfer“ darangemacht, die Warner vor Faschismus und Krieg im Rahmen der Kirche durch Berufsverbote mundtot zu machen. Hierzu gehört auch der Kampf um den „Fall Eckert“, das Buch enthält wichtige Dokumente dazu (S.204ff). Besonders eindrucksvoll ist das mutige Auftreten religiöser Sozialisten noch nach dem Sieg der Nazis: das Solidaritätsschreiben von Kappes an einen führenden Sozialdemokraten hinein in das KZ Kislau (S. 234f) sowie die Predigt des damals 28jährigen und heute noch lebenden Ludwig Simon im Konzentrationslager Heuberg am 21. März 1933 (S.126ff).
Wer erinnerte sich bei uns nicht des Wortes von Blüm: Marx ist tot, Jesus lebt, womit der Mann Kapitalismus und Jesus doch gleichsetzte. Aber das Wort ist gar nicht neu, und auch die Rolle Blüms hatte in Weimar einige Vorläufer. Kappes geht (S.177) darauf ein, wie ein Industrie-Verbands-Boss inmitten der Krise genau jene Forderungen an die Arbeiterinnen und Arbeiter richtete, die wir auch heute hören können: Abbau der Sozialpolitik, Verlängerung der Arbeitszeit, Reduzierung der Löhne, Rückkehr zum Autoritarismus. Und es antwortete ihm ein damaliger Blüm mit einem, wie Kappes formuliert: „Scheingefecht“, das die ganze Gefährlichkeit der Parole „Arbeitsgemeinschaft“ gezeigt habe. Glänzend auch die Auseinandersetzung mit der Demagogie der Nazi-Programmatik (S. 183ff). Und auch da fühle ich mich an Aktuelles erinnert. Da wird der prokapitalistische Charakter des Nazismus getarnt, versteckt hinter der Redeweise des Kampfes gegen den Mammonismus und Materialismus, wobei Marxismus und Kapitalismus beide mammonistisch und materialistisch seien (S.189). Hören wir nicht Analoges immer mal wieder aus kirchenoffiziellem Munde, können wir es nicht insbesondere in Verlautbarungen aus Rom lesen?
Das Buch schildert Kappes Verhältnis zur Sozialdemokratie, zur Sowjetunion (in beiden Fällen gab es Unterschiede in den Haltungen Eckerts und Kappes', die aber beider Freundschaft und gegenseitige Solidarität nicht untergruben). Wichtig auch, worauf ich nicht mehr eingehen kann, Kappes Wirken in Palästina, wohin er von 1935 bis 1948 in die Emigration geht (S.242ff), seine Bemühungen um eine sowohl den Juden als auch den Arabern gerecht werdende Lösung der Probleme, wobei er deren Probleme auch in der Abhängigkeit von den imperialistischen Mächten (insbesondere Englands und Frankreichs) zeigt. Leider war sein Wirken erfolglos, und ersetzt man heute England durch USA, so sind gewisse, von Kappes frühzeitig gezeigte Gefahren, genau so auch heute noch vorhanden - zum Schaden von Juden und Arabern. Robert Steigerwald, in: Berliner Dialog Hefte 3/1995
Heinz Kappes (1893-1988) Pfarrer - Religiöser Sozialist - Quäker
1. Lebensabriß: geb. 30.11. 1893 als Pfarrersohn im badischen Fahrenbach; gest. 1.5.1988 in Stuttgart. „Evangelisch, Quäker“, wie er selbst betonte, obwohl er m.W. der DJV nicht (mehr) angehörte. 1922 verheiratet mit Else Kern, geschieden 1948. Jugend- und Sozialpfarrer in Karlsruhe; Religiöser Sozialist; 1924 Eintritt in die SPD. 1926-1930 SPD-Stadtverordneter; Stadtrat der SPD. 1933 strafversetzt nach Büchenbronn bei Pforzheim, 1934/35 für 9 Monate in Palästina (als Tourist). 1935 mit Hilfe der Quäker legale Ausreise nach Palästina, Zusammenarbeit mit englischen und amerikanischen Quäkern. 1939: 9 Monate Internierung in Jerusalem. Weigerung, für Deutschland noch einmal Kriegsdienst zu leisten (nach Teilnahme am I. Weltkrieg als Kriegsfreiwilliger, Offizier, hochdekoriert). Befreundet mit Dr. Magnes, Präsident der Universität Jerusalem, und mit Martin Buber. 1940-1948 bei der British Food Control. 1948 Rückkehr nach Karlsruhe, Rehabilitierung durch die Kirchenleitung, Religionslehrer sowie viele Tätigkeiten („Integraler Yoga“, „Anonyme Alkoholiker“, „Christlich-jüdische Zusammenarbeit“). Übersetzung der Hauptwerke Aurobindos: 2.853 Seiten (aus dem Englischen) als Beispiel einer „weltzugewandten Mystik“. Diese Übersetzungsarbeit und sein Eintreten für Aurobindos Werk sowie seine Mystikforschung (7 Jahre wöchentliche Vorträge über Mystik vor deutschen Juden in Palästina) bedarf einer eigenen religionswissenschaftlichen Würdigung. (Ich hoffe, diese gelegentlich nachzuliefern.) Dabei ist Heinz Kappes seinen Anfängen nicht untreu geworden: Bis zuletzt las er jeden Tag mit großer Freude ein Stück aus Christoph Blumhardts (d.J.) Werken.
2. Reich-Gottes-Kämpfer. 1934 fuhr der aus dem badischen Pfarramt verbannte Heinz Kappes von Unterjesingen bei Tübingen (wo er Unterschlupf gefunden hatte) mit dem Fahrrad zu einer Quäkertagung nach Pyrmont. Die ihm auferlegte Aufenthaltsbeschränkung ließ keine Bahnfahrt zu. Was war geschehen?
1933 Machtübernahme! In Staat und Kirche erfolgte der Ausbruch eines rauschhaften Führerkultes! Einladung aller badischen Pfarrer zum Einschwören auf den neuen Landesbischof am 18. Juli: Heinz Kappes erscheint nicht! Er will nicht bei den „Siegern“ sein. Er stellt sich als Pfarrer auf die Seite der Ausgegrenzten, Gefangenen und Entflohenen. In der Pfingstpredigt 1933 erinnert er an die 26.000 „Besiegten“, die bereits in Gefängnissen und „Arbeitslagern“ sitzen. Die Kirchenbehörde reagiert mit „schmerzlichem Bedauern“ auf Kappes' Demonstration. In seiner letzten Predigt vor Rel. Sozialisten am Karsamstag 1933 stellt er die Dialektik von Kreuz und Auferstehung ganz in den Mittelpunkt und endet mit dem subversiven Gebetsschrei: „Herr, Dein Reich komme!“ Heinz Kappes, klein, eher zart gebaut, aber ein Kämpfertyp, geht bis an die äußerste Grenze: er schreibt einen Solidaritätsbrief an den ehemaligen badischen SPD-Kultusminister Remmele (anläßlich des Todes von Remmeles Frau), der im KZ Kislau sitzt. Nun soll Kappes selber nach Kislau. Der badische Innenminister, der Landesbischof, der Oberkirchenrat sind gegen Kappes. Dieser kommt aber zunächst für 10 Tage ins Pforzheimer Gefängnis. Kappes erklärt nun selber, er müsse nach Kislau ins KZ, weil er dort einen seelsorgerlichen Auftrag habe.
Die Kirchenleitung bestätigt ihm zwar, daß er ein hochbegabter und diensteifriger Pfarrer sei - aber von der falschen Richtung. Die Presse macht ihn zum „Marxisten“, der nach Büchenbronn kam und die „Seelen des jungen Geschlechts ... vergiftete“. Zwangspensionierung und Kirchenstreik sind die Folgen: eine Abordnung von Büchenbronn, darunter sogar ein PG, verteidigt Kappes vor dem Dienstgericht. Das Ende: Ausweisung aus Baden! Und dann beginnt die Odyssee über Palästina, zurück nach Deutschland, zweite Heirat (mit der Holländerin Dr. Riek Lieseveld, gest. 1977). Nicht zu vergessen Else Lehle: seinen letzten Lebensabschnitt hat die Stuttgarter Arzthelferin mit großer Hingabe begleitet. Der Religionswissenschaftler und „Seelenheilpraktiker“ hatte sich ganz auf das helfende Gespräch von Person zu Person zurückgezogen.
Der Hauptteil des Buches stammt von dem Rostocker Kirchenhistoriker G. Wendelborn (ausgewiesen durch Bücher über Luther, Franziskus und Bernhard von Clairvaux). F.M. Balzer, einer der besten Kenner des Rel. Sozialismus, hat seine Einleitung (Vergleich zwischen Erwin Eckert und Heinz Kappes) sowie viele Materialien und Vorarbeiten beigesteuert. Balzer kannte wohl Kappes am besten. Ich bin Heinz Kappes auch einmal in Frankfurt am Main (im „Frankfurter Ring“, einem religiösen Forum besonders für Kirchenferne) begegnet und wir hatten einen ausführlichen Briefwechsel. Er konnte sagen: „Ich lebe im Bewußtsein der Reinkarnation!“ (Arnold Pfeiffer, auch ein Kenner des Rel. Sozialismus von Rang und Freund von Kappes, nannte uns beide scherzhaft die „Mystischen Heinze“.) Warum Kappes über den Religiösen Sozialismus und das Quäkertum hinaus zu Sri Aurobindo weitergegangen ist, kann man nur vermuten. Ich selbst habe bei Aurobindo eine Gottes- und Weltvorstellung gefunden, die das abendländische Denken über das Absolute und Letztgültige weit in den Schatten stellt.
Der Band enthält auch auf etwa 100 Seiten Quellen, und zwar 36 Predigten, Aufrufe, Reden von 1922-1933; 3 aus der Zeit danach, darunter das hochbedeutsame Memorandum an die Jewish Agency über „Araber und Juden“. Das letzte Stück ist ein Brief an L. Ragaz (1938). Das Buch sollte ursprünglich zu Kappes' 100. Geburtstag 1993 erscheinen: aus verlagstechnischen Gründen erschien es zum 101. Geburtstag. Es füllt eine Forschungslücke, sowohl was die Kirchengeschichte, als auch die Geschichte des Rel. Sozialismus und des Quäkertums in Deutschland betrifft.
(Über Sri Aurobindo und sein Erbe vgl. auch das neue Buch von Renate Börger: „Auroville. Eine Vision blüht, Connection-Verlag Niedertaufkirchen 1993, 235S.) Heinz Röhr in: „Christ und Sozialist“ und „Der Aufbau“.
Wie groß unaufgearbeitetes Erbe gerade auch in der Kirche sein kann, belegt das Buch über Heinz Kappes. Den beiden Verfassern ist es nicht nur gelungen ein gültiges Porträt dieses zu Unrecht in den Hintergrund getretenen badischen religiösen Sozialisten zu zeichnen. Neben einem eindrücklichen Zeitbild der Weimarer Republik und hervorragenden Quellentexten machen sie deutlich, wieviel Unbewältigtes die Institution Kirche bis heute noch mit sich herumschleppt. Der Neubeginn nach 1945 war allzusehr mit restaurativen Elementen in Theologie und Kirchenpolitik belastet, um Anregungen und Erkenntnisse eines Mannes wie Kappes zu einem wirklichen Neubeginn zu nutzen: Bis heute wird das Machtdenken in der Kirche nicht ausreichend reflektiert, gibt es zu wenig Arbeitnehmer in der Synode, hat demokratisches Denken es in der Kirche schwer sich durchzusetzen, sind zu viele Bindungen an den Staat bestehengeblieben: Auf alle diese Probleme wies Heinz Kappes schon vor 1933 hin, bis ihn eine allzu nationalistisch verblendete Kirchenleitung vom Amt suspendierte. Das Buch über Kappes enthält eine Fülle von Bußpredigten an die heute Lebenden. Seine Forderungen zum Umdenken sind nach wie vor aktuell. Das Buch enthält ein aufregendes Kapitel badischer Kirchengeschichte, das Lehrstücke genug auch für die gegenwärtige Diskussion über die Krise der Kirche enthält. Es gäbe so vieles aus der Vergangenheit zu lernen. Deshalb wünscht man diesem Werk möglichst viele Leser. Gerner-Wolfhardt in: Aufbruch, Badische Kirchenzeitung vom 17.12.1995
|
|